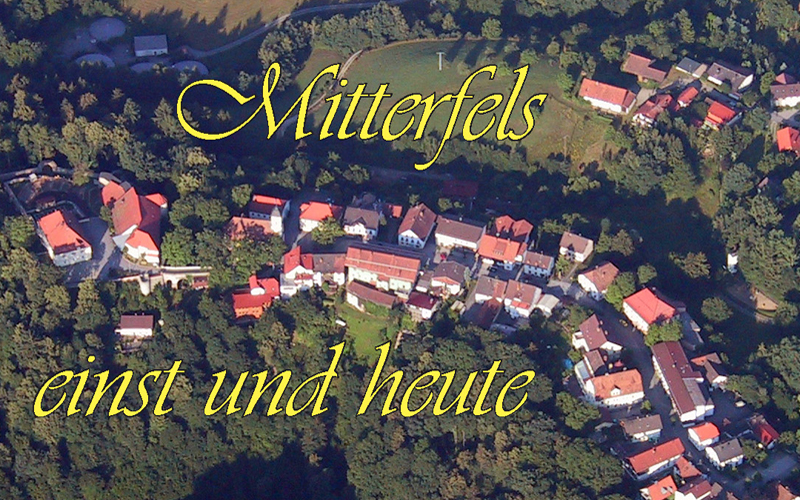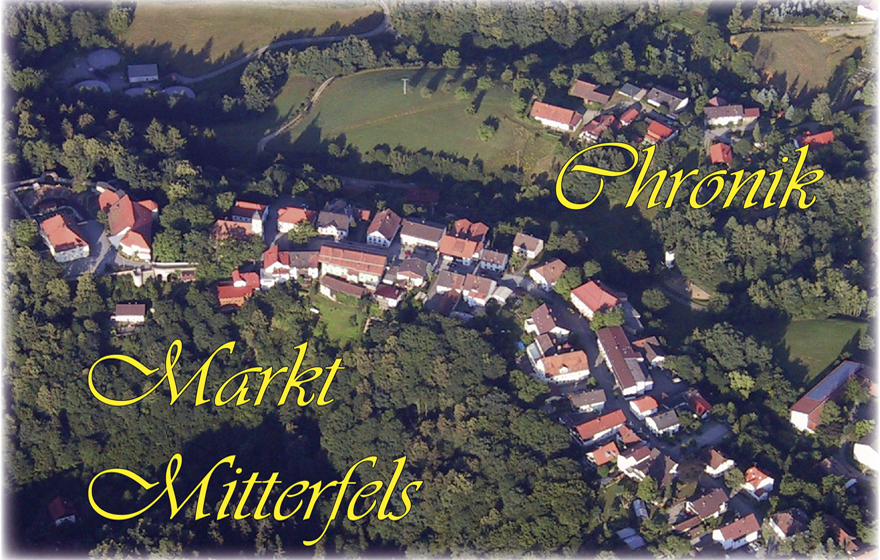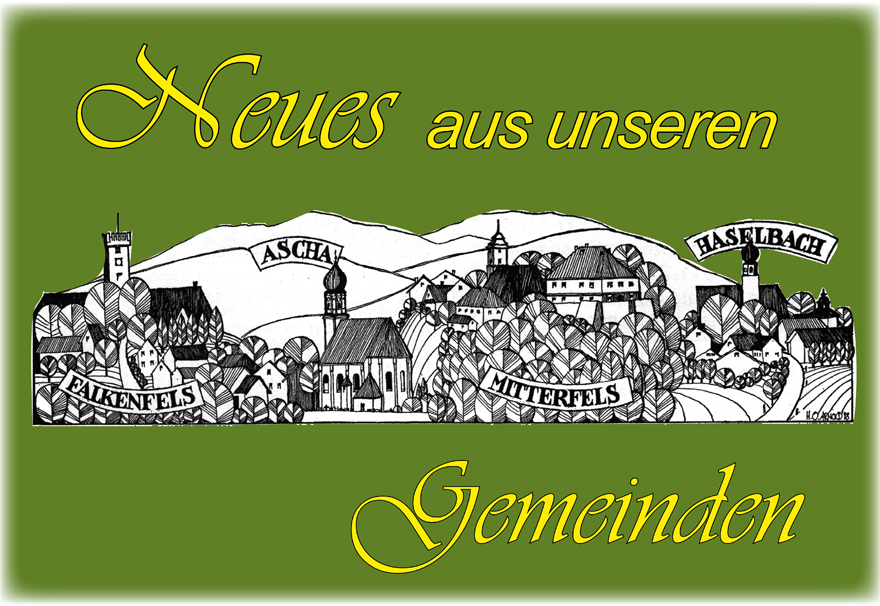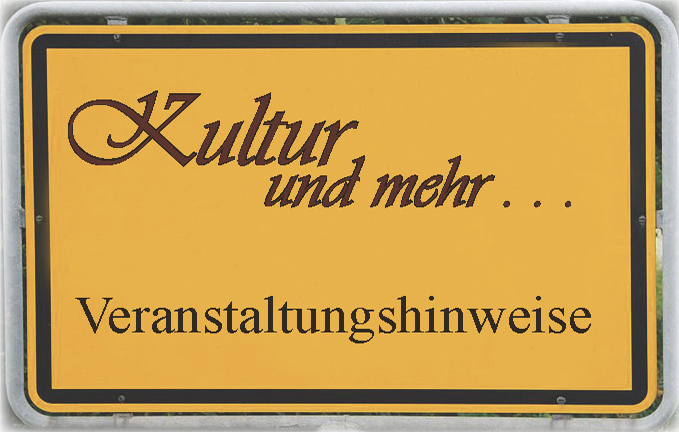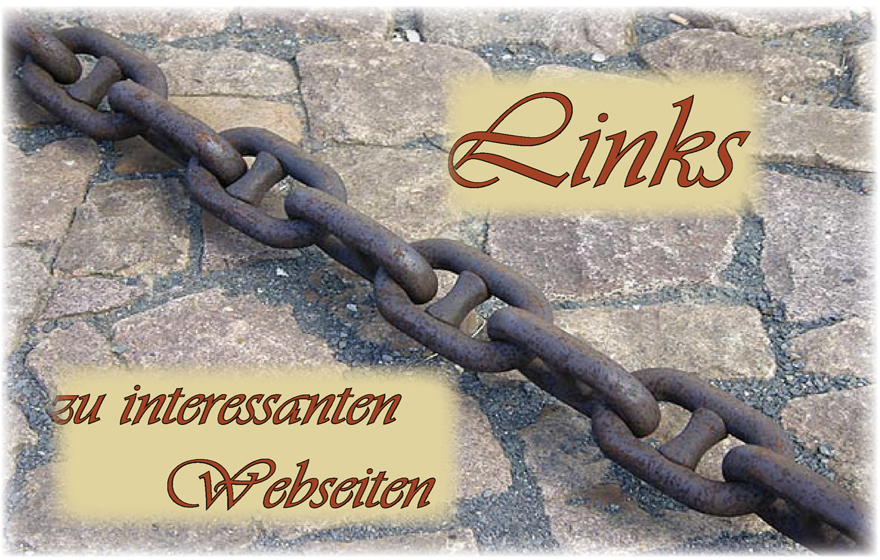Kulturelles Leben
Der Advent – eine Zeit für alle Sinne
Predigten an den Adventssonntagen in der Pfarreiengemeinschaft Mitterfels-Haselbach – gehalten von P. Dominik Daschner
Predigten zum 1. bis 4. Adventssonntag: Sehen - Hören - Tasten - Riechen und Schmecken
Predigt zum 4. Adventssonntag: Riechen und Schmecken
Als letztem unserer menschlichen Sinne wollen wir uns in unserer adventlichen Predigtreihe heute dem Geruchs- und Geschmackssinn widmen: dem Riechen und Schmecken. Lange Zeit hat man die beiden als zwei getrennte Sinne betrachtet. Heute weiß man, dass sie unmittelbar zusammenhängen. Sie brauchen zum Beweis dafür sich nur einmal beim Essen die Nase zuhalten. Und schon schmecken viele Speisen merkwürdig gleich, kann man gar nicht genau identifizieren, was man im Mund hat. Denn die Geschmacksrezeptoren auf unserer Zunge können nur vier Geschmacksrichtungen unterscheiden: Süß, Salzig, Bitter und Umami - eine herzhaft-würzige Note. Erst über die Nase, wenn sie aus dem Mund über den Rachen dorthin aufsteigen, nehmen wir die vielen unterschiedlichen Aromen der Speisen wahr.
Der Geruchs- und Geschmackssinn ist im Limbischen System unseres Gehirns angesiedelt, einem uralten Areal, abseits unseres bewussten Denkens. Deshalb wirken Gerüche, die wir wahrnehmen, auch ganz unmittelbar und unbewusst. Wir müssen zum Beispiel nur den typischen Geruch einer Schulturnhalle in die Nase bekommen, ohne dass wir uns dort befinden – und schon stellt sich bei manchem das ungute, beklemmende Gefühl im Magen wieder ein, das ihm das gefürchtete Geräte-Turnen während seiner Schulzeit immer beschert hatte. Oder, ins Positive gewendet: Mit dem Duft von Tannenzweigen, Glühwein, Bratwurst und Plätzchen, der jetzt über die Christkindlmärkte weht, werden in vielen Menschen unmittelbar schöne Erinnerungen an Weihnachten aus ihren Kindertagen wieder wach. Auch das macht die Märkte wohl so beliebt.
Düfte und Gerüche wecken ganz unmittelbar tief in unserem Gehirn abgespeicherte Erinnerungen. Bei schwer an Demenz erkrankten Menschen, zu denen der Zugang über Sprache, über Worte und logisches Denken nur noch schwer möglich ist oder die auf diesem Weg gar nicht mehr zu erreichen sind, lassen sich deshalb oftmals über vertraute Gerüche alte Erinnerungen wecken und Kontakt mit ihnen herstellen.
Das Riechen und Schmecken: Nicht nur tief verankert in unserem Menschsein …
Wie tief verankert Riechen und Schmecken in unserem Menschsein sind, das lassen auch die vielen Redewendungen erahnen, die darum kreisen. So sagen wir beispielsweise: Das war eine „dufte Veranstaltung“. Oder jemand ist „auf den Geschmack gekommen.“ Bei manchem Geruch „läuft einem das Wasser im Mund zusammen“. Oder es herrscht irgendwo „dicke Luft“. Jemand verreist und „schnuppert den Duft der großen, weiten Welt“. Etwas „stinkt mir“ oder ich „kann jemanden nicht riechen.“ Man kann auch in eine Sache „hineinschmecken“. Manche „stecken ihre Nase“ dagegen in Dinge, die sie nichts angehen. Ein anderer „rümpft die Nase“ über etwas. Es gibt „geschmackvolle“ Kleidung oder Wohnungseinrichtungen; während andere „keinen Geschmack daran finden“. Manches ist halt eine „Geschmacksfrage“. Und überhaupt „hält Essen und Trinken Leib und Seele zusammen“.
… sondern auch im Glauben und in der Liturgie
Wenn Riechen und Schmecken für unser Menschsein so zentral sind, wie diese Redewendungen veranschaulichen, dann nimmt es nicht wunder, dass der Geschmacks- und Geruchssinn auch in unserem Glauben und in der Liturgie eine Rolle spielt. Die alttestamentlichen Opfer, die Gott dargebracht wurden, sollten als wohlriechender und beruhigender Duft zu ihm aufsteigen (Lev 2,1-16). Der Apostel Paulus vergleicht die Erkenntnis Christi mit einem wohlriechenden Duft, der sich durch die Christen verbreitet. Wir sollen ein Wohlgeruch Christi in dieser Welt sein (2 Kor 2,15). Im christlichen Gottesdienst spielen deshalb seit jeher auch Duftstoffe eine Rolle, die das abbilden sollen: der duftende Weihrauch, der zur Ehre Gottes entzündet wird und zu ihm aufsteigt als Sinnbild für unser Gebet (Ps 141,2); oder der Chrisam – eine Mischung aus Öl und Duftstoffen – der zum Beispiel bei der Feier der Firmung verwendet wird.
… und bei den Gleichnissen Jesu ist das „Himmelreich“ ein Festmahl
In ganz besonders deutlicher Weise spielt die Heilige Schrift auf unseren menschlichen Geschmackssinn an, wenn sie das endzeitliche Heil - das, was uns bei Gott im Himmel erwartet - mit einem Festmahl vergleicht: mit einem himmlischen Hochzeitsmahl. Ein üppiges Mahl mit erlesensten Speisen und besten Weinen, wie schon der Prophet Jesaja es ausmalt (Jes 25,6) und worauf auch Jesus mit seinem Weinwunder in Kana verweist. In seinen Gleichnissen vergleicht Jesus das Himmelreich mit einem festlichen Mahl (Mt 22,1-14). Ein Mahlhalten wird es sein, bei dem rundum Freude herrscht. Und sicher ein Genuss ohne Reue, wo wir nicht mehr Kalorien zählen oder auf Cholesterin achten müssen. Gott selber wird uns an seinem Tisch Platz nehmen lassen und uns der Reihe nach bedienen (Lk 12,37), so sagt Jesus.
„Riechen will ich all die Kostbarkeiten deiner Schöpfung … Schmecken will ich alles, was auf der Zunge zergeht, guter Gott …“
In der Eucharistie dürfen wir schon einen Vorgeschmack verkosten auf dieses himmlische Hochzeitsmahl, wenn bei der Kommunion, im eucharistischen Mahl Christus selbst unsere Speise wird, wenn wir uns ihn regelrecht einverleiben dürfen, damit wir auf den Geschmack kommen für ein Leben in seiner Nachfolge und aus seinem Geist; damit wir Geschmack finden am Leben.
So ist auch ein Gebet1 überschrieben, mit dem ich unsere adventliche Predigtreihe über unsere menschlichen Sinne beschließen möchte:
Riechen will ich all die Kostbarkeiten deiner Schöpfung, guter Gott,
den Duft der Blumen und der Blüten,
die Luft des Waldes und das Wachs der brennenden Kerzen,
den Duft frischen Brotes und Kaffees.
Dank sei dir für die Düfte und Gerüche, guter Gott,
wie wohltuend sie sind, wie belebend.
Schmecken will ich alles, was auf der Zunge zergeht, guter Gott,
die Früchte der Erde und des Feldes,
das Süße und das Saure, das Milde und das Bittere,
die Nahrung und die Getränke.
Dank sei dir für den Geschmack, guter Gott,
wie vielfältig, wie bereichernd.
Kosten will ich alles, was das Leben mir bringt, guter Gott,
die Erfahrungen und Träume,
die Menschen, Erinnerungen,
das Schöne und das Schmerzliche.
Dank sei dir für den Schatz des Lebens, guter Gott,
wie reich ist er, wie kostbar, wie gut.
1 Ursula Klauke/Norbert Brockmann, Angedacht. Materialien für Gruppenarbeit und Gottesdienst. Mainz 1997, 123f.
Predigt zum 3. Adventssonntag: Tasten
In unserer adventlichen Predigtreihe über unsere menschlichen Sinne sind wir heute beim Tastsinn angelangt. Er ist vielleicht am wenigsten im Bewusstsein, wenn von unseren Sinnen die Rede ist. Dabei ist die Haut, über die wir Berührungen wahrnehmen und mit der wir unsere Umwelt ertasten, das größte Organ des Menschen. Sie markiert die Grenze zu unserer Mitwelt. Und ist zugleich unser größtes Sinnesorgan.
Die Welt tastend und spürend be-greifen
Schon von Mutterleib an erfahren wir tastend und spürend unsere Umwelt. Indem ein Kind alles berührt, was es zu fassen bekommt, versucht es, die Dinge, die Welt – im wahrsten Sinn des Wortes – zu be-greifen. Und das hört beim erwachsenen Menschen nicht auf. Nicht von ungefähr begegnen uns in Geschäften und Ausstellungsräumen immer wieder aufgestellte Verbotsschilder mit der Aufschrift „Bitte nicht berühren!“
Tag für Tag bestimmen unzählige Berührungen unseren Alltag. Sie bringen uns in Kontakt mit der Welt. Morgens, wenn ich aufgestanden bin, spüre ich beim Waschen das Wasser in meinen Händen, auf meinem Gesicht. Draußen nehme ich auf meiner Haut die Wärme und die Kälte wahr. Beim Spazierengehen weht der Wind durch die Haare und ins Gesicht. Durch den Tastsinn nehme ich die Äußerungen der Natur wahr: die Elemente und ihr Spiel.
Im Berühren und Berührt-werden überwinden wir die Grenze zwischen Ich und Du
Über ihn reagiere ich auf Schmerz, spüre den warmen Händedruck bei einer Begegnung, das zärtliche Streicheln und eine Umarmung oder den Kuss auf den Lippen. Der Tastsinn lässt uns Menschen die Nähe und das Glück einer Begegnung erfahren. Im Berühren und Berührt-werden überwinden wir die Grenze zwischen Ich und Du, geschieht Kontaktaufnahme. Der Tastsinn bringt Menschen einander näher.
Und der Tastsinn spricht Gefühle an, lässt in uns klingen, was häufig in Worten nur schwer oder gar nicht aussprechbar ist. Worte geben es nur unzulänglich wieder. Ein Händedruck dagegen sagt stumm: „Ich bin dir gut. Ich will mit dir verbunden sein.“ Eine Umarmung vermittelt ohne Worte: „Ich freue mich, dass du da bist! Ich fühle mich wohl und geborgen in deiner Gegenwart. Ich mag dich.“
Haut - ein Spiegel unserer Seele
Weil der Tastsinn – das Fühlen - mit unseren Ge-fühlen verbunden ist und mit seinen vielen Rezeptoren in unserer Haut sitzt, ist die Haut auch ein Spiegel unserer Seele. Seelische Probleme äußern sich deshalb bisweilen in Form von Anzeichen auf der Haut, in Form von Hautkrankheiten. Wenn uns etwas „unter die Haut geht“, wie wir sprichwörtlich sagen. Oder jemand sagt einem anderen: „In deiner Haut möchte ich nicht stecken!“ – und meint damit den ganzen Menschen und die Situation, in der dieser sich befindet.
Menschwerdung Gottes: ER wollte „in der menschlichen Haut stecken“
Was jemand mit dieser Redewendung für sich vermeiden will, genau das hat Gott in seiner Menschwerdung getan. Er wollte hautnah spüren, was es heißt, ein Mensch zu sein. Er wollte selbst in unserer menschlichen Haut stecken. Darum ist er in Jesus Christus Mensch geworden, hat unser menschliches Leben geteilt. Das feiern wir an Weihnachten. Darauf gehen wir in diesen Wochen des Advents zu. Und es kommt deshalb wohl nicht von ungefähr, dass viele Menschen sich in dieser Zeit berühren lassen – mehr als sonst -, von den Bedürfnissen ihrer Mitmenschen, sich anrühren lassen vom Leid in der Welt.
Gott ist für uns Menschen „berührbar“ geworden
Gott ist an Weihnachten in unsere menschliche Haut geschlüpft – nicht bloß auf Probe, auf Zeit, als kurzfristige Verkleidung, sondern ganz und gar; mit allem, was zum Mensch-sein dazugehört. Dadurch ist Gott für uns Menschen berührbar geworden. Die Evangelien erzählen uns von unzähligen Berührungen; wie Jesus sich von Menschen berühren lässt, die in ihrer Not den Kontakt zu ihm und Hilfe bei ihm suchen. Jesus hat selbst immer wieder Kranke berührt und sie dadurch geheilt. Der Schmerz des Synagogenvorstehers über den Tod seiner kleinen Tochter rührt ihn innerlich an. Er fasst das tote Kind an der Hand und gibt es dem Leben und seinem Vater zurück. Der Apostel Thomas darf sogar den Auferstandenen berühren – seine Wundmale. Im Berühren, mit seinen Sinnen erkennt er und findet tastend zum Glauben.
Das „Berührt-werden von Gott“ ist eingegangen in die Sakramente der Kirche
Und, liebe Schwestern und Brüder, dieses Berührt-werden von Gott, durch Jesus, das hat nicht geendet nach den wenigen Jahrzehnten, in denen Jesus über unsere Erde gewandelt ist. Es ist eingegangen in die Sakramente der Kirche. Viele gehen mit Handauflegungen, Salbungen oder anderen Berührungen einher und vermitteln damit über den Hautkontakt göttliches Heil. Das Übergossen-werden mit Wasser bei der Taufe lässt uns spüren, wie Gott uns mit neuen Leben erquickt. Die Salbung mit Öl – bei der Taufe, bei der Firmung, bei der Krankensalbung – sie macht erfahrbar, wie zärtlich uns Gott zugewandt ist, wie er sich uns heilschaffend zuwendet. Die Handauflegung, die bei der Lossprechung in der Beichte vorgesehen ist, vermittelt ohne Worte: Es ist wieder gut! Gott legt neu seine Hand auf dich. Bei der Trauung oder bei der Weihe gibt sie den Betreffenden zu verstehen: Ich begleite dich auf deinem Weg in der Ehe oder im kirchlichen Dienst. Ich halte meine Hand dabei schützend über dich. All diese heilshaften Zusagen geschehen in der Liturgie durch Zeichenhandlungen, im Berührt-werden, auf dem Weg über unseren Tastsinn.
Mit einem entsprechenden Gebet möchte ich deshalb schließen:
Wir sehnen uns danach, von dir berührt zu werden, großer Gott.
Wir möchten deine Nähe spüren,
uns in deine Hände geben
und Ruhe finden, Wärme und Sicherheit.
Hilf uns, ein Ge-spür zu entwickeln für deine Nähe,
be-rühr-bar zu werden und zu bleiben
für die Menschen, mit denen wir leben,
dich zu be-greifen,
den fernen und den nahen Gott.
Predigt zum 2. Adventssonntag: Hören
Das Sehen ist in unserem Alltag wohl der wichtigste menschliche Sinn, mit dem wir unsere Umwelt wahrnehmen. Doch für unseren Glauben ist ein anderer Sinn noch entscheidender: das Gehör. Denn „der Glaube kommt vom Hören“, wie der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt. Darum möchte ich mich in meiner adventlichen Predigtreihe über unsere vier Sinne heute dem Hören widmen.
„Auf Durchzug schalten“ – oder: Bewusstes Zuwenden im Hinhören
Zunächst ist Hören die Wahrnehmung verbaler oder klanglicher Ausdrucksformen. Doch beschränkt sich das Hören nicht allein auf eine rein passive Aufnahme, sondern kann den Charakter eines aktiven Tuns annehmen, nämlich dann, wenn es sich um eine bewusste Zuwendung im Hinhören handelt. Anders als unsere Augen können wir unsere Ohren ja nicht verschließen. Die Schallwellen sämtlicher Umweltreize dringen ungehindert in unser Ohr. Doch beim Hören ist nicht nur das Ohr beteiligt, sondern auch unser Gehirn. Es arbeitet wie ein Filter, der entscheidet, welche Höreindrücke wir an uns heranlassen und was wir ausblenden. Denn auch wenn wir unsere Ohren nicht aktiv verschließen können, so können wir sie eben doch auf Durchzug schalten. Es geht beim Hören also um ein bewusstes Zuhören.
Und das ist bisweilen eine Kunst. Hören will gelernt sein. Die ständige Reizüberflutung durch Geräusche, Worte und Klänge lässt unser Hörvermögen mehr und mehr abstumpfen. Es bedarf einer bewussten Entscheidung, sich auf die Wahrnehmung durch den Gehörsinn zu konzentrieren, um „ganz Ohr zu sein“, wie wir redensartlich sagen, um jemandem wirklich „sein Ohr zu leihen“. Die innere Gestimmtheit muss offen sein für das zu Hörende. Wirkliches Zuhören zielt auf den Sinn des Gesagten; es ist aufmerksam für die Unter- und Obertöne in der gesprochenen Botschaft. Was meinst du? Was empfindest du? Was verschweigst du? Welche Not, welche Hoffnung spricht aus dir?
„Ganz Ohr sein“ für das Wort Gottes
Das Wort Gottes, das uns in der Liturgie verkündet wird, verlangt nach hörender Annahme. Deshalb singen wir zu Recht mit einem Lied aus unserem Gotteslob: „Herr, gib uns Mut zum Hören, auf das, was du uns sagst.“ Das Hören auf die Heilige Schrift, in der sich Gottes Zuwendung zu seinem Volk worthaft manifestiert, ist ein sehr wichtiger gottesdienstlicher Akt: hörsam zu werden für Gott. Das aufmerksame Hören auf Gottes Wort ist die Voraussetzung dafür, hierauf zu antworten.
Hören als ein „Sich-Einlassen“ auf Gott
So wie wir es von Maria im Evangelium erzählt bekommen. Sie war eine große Hörende. Aus dem bewussten Hören auf die Botschaft des Engels erwächst ihr Ja zu Gottes Heilsplan als ihre Antwort. Aus dem Hören, aus dem Hörsam-sein wird Gehorsam. Gehorsam im christlichen Sinn meint eben nicht ein willkürliches Verfügen über einen anderen auf der einen und ein blindes Befolgen einer Anordnung auf der anderen Seite. Das ist falsch verstandener Kadaver-Gehorsam. Christlicher Gehorsam, wie ihn Ordensleute bei ihrer Profess geloben, oder Priester bei ihrer Weihe, er meint ein gemeinsames aktives Hinhören auf das, was nötig ist, auf den Willen Gottes und auf die Zeichen der Zeit, und die in Demut gegebene Antwort im Sich-Einlassen darauf. Ganz nach dem Vorbild Marias bei der Verkündigung.
Wenn wir uns so wie Maria von Gottes Wort treffen lassen und darauf Antwort geben mit unserem Leben, werden wir zu Angehörigen – im tiefsten Sinn des Wortes – zu An-Gehör-igen der Familie Gottes, jener Ursprungsgemeinschaft im Glauben. Angehörige der Familie Jesu Christi sein, ist ein Bekenntnis zur Gemeinschaft der Hörenden – zur Gemeinschaft derer, die auf Gottes Wort hören – auf jenes Wort, das im Letzten Christus selber ist: das menschgewordene Wort Gottes – und die daraus ihr Leben gestalten.
Doch wie kommt man zum rechten Hören?
Ein paar Gedanken dazu. Das Ohr entsteht als erstes Sinnesorgan des Menschen – und es erlischt im Tod als letztes. Schon im Mutterleib verleibt sich das Kind die Tonschwingungen, die Stimmungen seiner Mutter und seiner Mitwelt ein. Ein schöner Gedanke ist das: der Mutterschoß, der erste Andachtsraum des hörenden Menschen.
Die Tatsache, dass das Ohr auch für unseren Gleichgewichtssinn zuständig ist, zeigt seine existentielle Aufgabe für unser Leben. Im Hören auf Gott und auf unsere Mitwelt bleibt unser Leben im Gleichgewicht, bleiben die Dinge im Lot. Das Ohr ist ein Vermittlungsorgan. Es ist der Ort der Balance und der Entscheidungen. Angehörige der Familie Jesu Christi sein, heißt deshalb – besonders jetzt in dieser Adventszeit – zur Besinnung kommen, zu seinen Sinnen, zum rechten Hören.
Mit einem hörsamen Ohr, das dazu nötig ist, möge Gott uns segnen:
Sei gesegnet mit dem Ohr, das der Stille traut,
denn wer sich ihr zuwendet, zu dem spricht Gott.
Sei gesegnet mit dem Ohr, das leisen Tönen nachspürt.
Hier offenbart sich die Schönheit der Schöpfung.
Sei gesegnet mit dem Ohr, das zuhört.
Hier können Menschen Heimat finden.
Sei gesegnet mit dem Ohr, das den Frieden hört.
Hier kann in Schmerz und Leid Versöhnung geschehen.
Sei gesegnet mit dem Ohr, das die Freude kennt.
Hier wird erlöst, was in sich gefangen ist.
Sei gesegnet mit dem Ohr, das der Stille traut,
denn wer sich ihr zuwendet, zu dem spricht Gott.
Predigt zum 1. Adventssonntag: Sehen
Mit diesem Sonntag fängt eine neue Zeit an: der Advent. Für viele ist er eine ganz besondere Zeit im Jahreslauf: mit seinen Bräuchen, mit der besonderen Stimmung in diesen Wochen vor Weihnachten. Der Advent ist eine Zeit, die alle unsere Sinne anspricht. Die vielen Lichter, die in den Straßen leuchten und die Dunkelheit erhellen. Mit besonderer Musik, die es in diesen Wochen zu hören gibt: die alten Adventslieder und dazu die modernen Songs, die jetzt im Radio laufen; „Last Christmas“ etc. Auch bestimmte Gerüche prägen diese Zeit: Plätzchenduft und Glühwein; die Gewürze Zimt und Kardamom. Und auch unser Tastsinn ist angesprochen. Viele Menschen lassen sich in dieser Zeit auf Weihnachten zu besonders anrühren von der Not ihrer Mitmenschen – mehr als sonst. Der Advent – eine Zeit für alle Sinne. Ich möchte darum an den vier Adventsonntagen unseren menschlichen Sinnen ein wenig nachspüren und der Frage nachgehen, wie sie auch mit unserem Glauben zu tun haben.
Advent hat mit Sehen, mit Ausschau-halten zu tun.
Der dominante Sinn, mit dem wir Menschen unsere Umwelt wahrnehmen, ist sicher das Sehen. Durch das Auge nimmt der Mensch rezeptiv die Welt wahr. An etwas oder jemandem Interesse haben, einem anderen Menschen Aufmerksamkeit schenken, bedeutet zugleich, etwas oder jemanden in den Blick nehmen, ansehen. Zugleich verleihen wir ihm dadurch auch Ansehen. Umgekehrt: Wenn ich einen Menschen nicht anschaue, meinen Blick sogar von ihm abwende, dann drücke ich damit aus, dass er mir gleichgültig ist, dass ich ihn keines Blickes würdige. Wenn es Streit gab und deshalb etwas zwischen uns steht, dann sagen wir: „Den kann ich nicht mehr sehen.“ Oder: „Den will ich gar nicht mehr sehen.“ Wenn wir mit einem anderen Menschen Kontakt aufnehmen wollen, dann suchen wir den Blickkontakt mit ihm, wollen wir ihm ins Gesicht sehen.
Diese Erfahrung aus dem zwischenmenschlichen Bereich wird in der Bibel auch auf die Beziehung des Menschen zu Gott angewandt. Der Psalmbeter bittet Gott darum, sein Angesicht nicht von ihm zu nehmen, sondern sich ihm zuzuwenden. Der gläubige Mensch hält sein Leben lang Ausschau nach Gott, sucht sein Antlitz und wünscht sich und anderen, dass Gott sein Angesicht über ihnen leuchten lässt.
 Die Schrifttexte des ersten Adventssonntags mahnen uns zur Wachsamkeit auf Gott hin. Vielleicht kennen Sie den berühmten Holzschnitt von Walter Habdank, der Menschen auf einer Aussichtsplattform zeigt, die mit einem Fernrohr sehnsüchtig in die Ferne blicken und wachsam Ausschau halten nach etwas Kommendem, nach dem Kommenden, den wir in diesen Wochen erwarten: Jesus Christus. Ein wunderbares Adventsbild ist das. Advent hat mit Sehen, mit Ausschau-halten zu tun.
Die Schrifttexte des ersten Adventssonntags mahnen uns zur Wachsamkeit auf Gott hin. Vielleicht kennen Sie den berühmten Holzschnitt von Walter Habdank, der Menschen auf einer Aussichtsplattform zeigt, die mit einem Fernrohr sehnsüchtig in die Ferne blicken und wachsam Ausschau halten nach etwas Kommendem, nach dem Kommenden, den wir in diesen Wochen erwarten: Jesus Christus. Ein wunderbares Adventsbild ist das. Advent hat mit Sehen, mit Ausschau-halten zu tun.
Holzschnitt von Walter Habdank
Sehen ist mehr als nur äußerliches Wahrnehmen mit dem Sinnesorgan Auge.
Die ganze Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung beginnt mit dem Wort: „Es werde Licht!“ Seither verbinden wir alles Göttliche mit Licht – im Gegensatz zum Dunkel dieser Welt, das wir in dieser Jahreszeit besonders bedrückend erfahren. „Gott ist Licht, und keine Finsternis ist in ihm“, so heißt es im Ersten Johannesbrief. Dieses göttliche Licht scheint in unsere Welt herein. In Jesus Christus ist es uns aufgestrahlt, hat uns besucht „das aufstrahlende Licht aus der Höhe“, wie es im Benedictus heißt, dem Lobgesang des Zacharias. Die vielen Lichter zu Weihnachten an den Christbäumen und drum herum sind ein Bild dafür. Das wachsende Licht der Kerzen am Adventskranz führt uns behutsam hin zu diesem Licht.
Doch Sehen, liebe Schwestern und Brüder, ist mehr als nur äußerliches Wahrnehmen mit dem Sinnesorgan Auge. Noch dazu können wir – anders als bei unseren sonstigen menschlichen Sinnen – unsere Augen bewusst verschließen, wenn wir etwas nicht sehen oder wahrnehmen wollen.
Mit dem Herzen sehen wir mehr.
Wir Menschen können verschieden sehen: mit dem bloßen Auge oder aber mit dem Herzen. Mit den Augen nehmen wir nur wahr, was außen ist, was somit immer auch ein Stück weit äußerlich bleibt. Unsere Augen bleiben an der Außenseite hängen, an Äußerlichkeiten. Mit dem Herzen dagegen sieht man mehr, sieht man tiefer: was hinter den Dingen steckt; was etwas bedeutet; was etwas wert ist. Sie kennen bestimmt das berühmt gewordene Wort aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Der Epheserbrief spricht von den „erleuchteten Augen des Herzens“. Mit den Augen, mit unserem menschlichen Sehsinn, können wir Gott nicht erfassen. „Niemand hat Gott je gesehen“, so heißt es in der Heiligen Schrift. Aber wenn wir die Welt mit dem Herzen betrachten, können wir Gottes Spuren in ihr erkennen und in unserem Leben entdecken. Glauben heißt deshalb: mit dem Herzen sehen.
Bisweilen benötigen wir Sehhilfen: „Kontaktlinsen des Herzens“ …
Doch bisweilen ist unser Sehsinn gestört, haben wir einen Knick in der Optik. Dann benötigen wir eine Brille als Sehhilfe. Und das nicht nur im körperlichen, sondern auch im übertragenen Sinn. Denn wer kennt sie nicht, die blinden Flecken in der eigenen Optik? Wenn wir zu schwarz sehen oder rosarot; alles zu eng sehen, von oben herabsehen, den anderen übersehen oder nicht sehen wollen. Dann brauchen wir Nachhilfen für das Sehen mit dem Herzen: Kontaktlinsen des Herzens, Brillen des Herzens oder gar als radikalen Eingriff einen Laserstrahl, der altes Sehen wegbrennt und neues Sehen möglich macht.
… die „Frohe Botschaft“
Jesus bietet uns mit seiner Frohen Botschaft diese Sehhilfen an. Bei ihm und seinem Evangelium können wir in die Sehschule des Lebens gehen, die uns zum echten Sehen verhilft, uns den richtigen Blick aufs Leben vermittelt. Er lässt uns den liebevollen Blick erkennen, mit dem Gott uns anschaut, so dass wir auch uns selbst richtig wahrnehmen und auch unsere Mitmenschen neben uns. In seinem Licht sehen wir tiefer, blicken wir durch. Wir können vorausschauen und zugleich rücksichtsvoll sein und zuversichtlich. Mit dieser Sehhilfe ausgestattet, können wir im Umgang mit anderen manchmal beide Augen zudrücken. Und manchmal werden uns die Augen aufgehen. Ganz bestimmt am Ende - wenn uns einmal das ewige Licht leuchten wird, das göttliche Licht.
Neueste Nachrichten
- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (74)
- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Landes-Jury zu Besuch in Haselbach
- Mitterfels. Glas-Kunst-Ausstellung „Anja Listl – Glas. Kunst. Passau!“ im Burgmuseum
- Wechsel an der Spitze der Bücherei Mitterfels
- Haselbach. Landes-Jury kommt
- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr
- Burgtheater Mitterfels. Herzschmerz unter freiem Himmel
- Mitterfels. Sommerferienprogramm 2025
- Bücherei Falkenfels. Sommerferien-Leseclub
- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels
- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels
- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen
- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert
- MM 14/2008. Vorstellung der zentralen Themen im MM 14
- MM 14/2008. Gemeindebildung in Bayern
- MM 14/2008. Mitterfels war trotz des Sitzes eines Gerichts und vieler Ämter bis 1968 ein Dorf
- MM 14/2008. „Die ‚minderbemittelte Klasse‘ sollte Ersparnisse verwahren und vergrößern können …“
- Neues aus unseren Gemeinden
- Bücherei Mitterfels. Leseangebot für Kinder wird erneuert …
- Dressur- und Springturnier des RFV Mitterfels an zwei Tagen
- Pfarreiengemeinschaft Mitterfels/Haselbach. Trödelmarkt beim Pfarrfest
- Peter Vogl zum Ehrenvorstand ernannt …
- Kleiner Weltladen Mitterfels: Verein wird Ende 2025 aufgelöst
- Autoren und Maler für „Buch & Bild“ gesucht …
- Falkenfels. Über 250 Teilnehmer beim „Büscherl-Trail“
Meist gelesen
- Unser "Bayerwald-Bockerl" erlebte seinen 100. Geburtstag nicht
- Vor 27 Jahren: Restaurierung der einstigen Kastensölde in Mitterfels abgeschlossen
- Markterhebung - 50 Jahre Markt Mitterfels
- Mühlen an der Menach (08): Wasserkraftnutzung in Kleinmenach und an den Nebenflüssen (in Groß- und Kleinwieden und Aign)
- Mühlen an der Menach (21): Die Höllmühl
- Menschen aus unserem Raum, die Geschichte schrieben (1): Johann Kaspar Thürriegel
- Dakemma, Bäxn, Moar ....
- Begegnung mit Menschen (6). Drei Wandgemälde in der Volksschule Mitterfels von Willi Ulfig
- Mühlen an der Menach (05): So wurde in Frommried (und auch in anderen Mühlen) aus Getreide Mehl
- Erinnerungen an einen "Bahnhof" besonderer Art: Haltepunkt Wiespoint
- Mühlen an der Menach (04): Frommried, eine der ältesten Mühlen
- Impressum
- Mühlen an der Menach (11): Die Mühle in Recksberg
- Das alte Dorf im Wandel
- Mühlen an der Menach (03): Ein Perlbach namens Menach
- Ortskernsanierung in Mitterfels (Stand 1995)
- Die Kettenreaktion
- Datenschutzerklärung
- Mühlen an der Menach (07): Die Hadermühl
- Sparkasse Mitterfels - 10 Jahre älter als bisher bekannt
- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .
- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)
- Es begann in Kreuzkirchen
- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels
- 2021: VG Mitterfels wurde 44
- Eine Bücherei entsteht
- Begegnung mit Menschen (1). Erinnerungen an Balbina Gall - Hebamme von Mitterfels
- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl
- Das ehemalige Benediktinerkloster Oberaltaich - seine Bedeutung für unseren Raum
- Ergebnis der Bundestagswahl 2017 in der VG Mitterfels
- Wandern auf kurfürstlichen Spuren
- Schloss Falkenfels als Flüchtlingslager
- Mühlen an der Menach (01) - Vorstellung der Themenreihe
- Hausnummern - Spiegelbild für Dorf und Gemeinde
- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels
- Kirchengrabung in Haselbach mit Fund romanischer Wandziegelplatten im Jahre 1990
- Widder an den Thurmloch-Wassern
- Sind wirklich die Falken die Namensgeber von Falkenfels?
- Mühlen an der Menach (02): Wasserkraftnutzung an der Menach
- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Jahreshauptversammlung 2017 mit Exkursion
- Mühlen an der Menach (19): Die Ziermühl
- Erinnerungen eines Landarztes
- Über den Mitterfelser Dorfbrunnen
- Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft im Seifenkistenrennen 1950 in Mitterfels
- Sie waren Lehrbuben auf Schloss Falkenfels
- Mühlen an der Menach (25): Die "Wartnersäge" bei den Bachwiesen
- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Das neue Mitterfelser Magazin 21/2015
- Zentrales Gemeindearchiv: Altes Kulturgut besser nutzen
- Zur Ortskernsanierung (1995): Begegnung mit Stuttgarter Studenten
- Neues Mitterfelser Magazin 19/2013 erschienen
Meist gelesen - Jahresliste
- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .
- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)
- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels
- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl
- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels
- Burgmuseumsverein Mitterfels. Objekt des Monats Oktober 2016 . . . und frühere Objekte
- History of Mitterfels
- Der Haselbacher Totentanz
- Online-Beiträge des Mitterfelser Magazins 1/1995 bis 10/2004
- Bayerische Landesausstellung 2016 in Aldersbach. Bier in Bayern
- Kalenderblatt
- Mitterfels. Theaterspiel und Menü im Gasthaus „Zur Post“
- Landesausstellung "Bier in Bayern" in Alders- bach
- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Führung Friedhof St. Peter in Straubing
- Club Cervisia Bogen. Bogen: Startschuss für D‘Artagnans Tochter und die drei Musketiere
- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
- Neues Kinderprogramm im Gäubodenmuseum Straubing
- Landkreis Straubing-Bogen. Hans Neueder gibt nach 25 Jahren sein Amt als Kreisheimatpfleger auf
- Windberger Theater-Compagnie. „Lokalbahn“ - Rollen mit Herz und Seele gespielt
- Jahresversammlung 2016 des AK Heimatgeschichte Mitterfels mit Exkursion nach Elisabethszell
Meist gelesen - Monatsliste
- Neues aus unseren Gemeinden
- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (74)
- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels
- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels
- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert
- MM 14/2008. Gemeindebildung in Bayern
- MM 14/2008. Mitterfels war trotz des Sitzes eines Gerichts und vieler Ämter bis 1968 ein Dorf
- MM 14/2008. Vorstellung der zentralen Themen im MM 14
- MM 14/2008. „Die ‚minderbemittelte Klasse‘ sollte Ersparnisse verwahren und vergrößern können …“
- Burgtheater Mitterfels. Herzschmerz unter freiem Himmel
- Mühlenmuseum Haibach. Für Besucher geöffnet
- Falkenfels. Wieder Büscherl-Trail im Rahmen des Sportfestes
- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr
- Mitterfels. Ferienprogramm auf dem Reiterhof Gold
- Mitterfels. Glas-Kunst-Ausstellung „Anja Listl – Glas. Kunst. Passau!“ im Burgmuseum
- Ascha. 500 Euro für den Verein für Kinder
- Bücherei Mitterfels. 500 Euro für neue Medien
- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen
- Haselbach. Landes-Jury kommt
- JU Falkenfels. „Neue Herausforderungen“